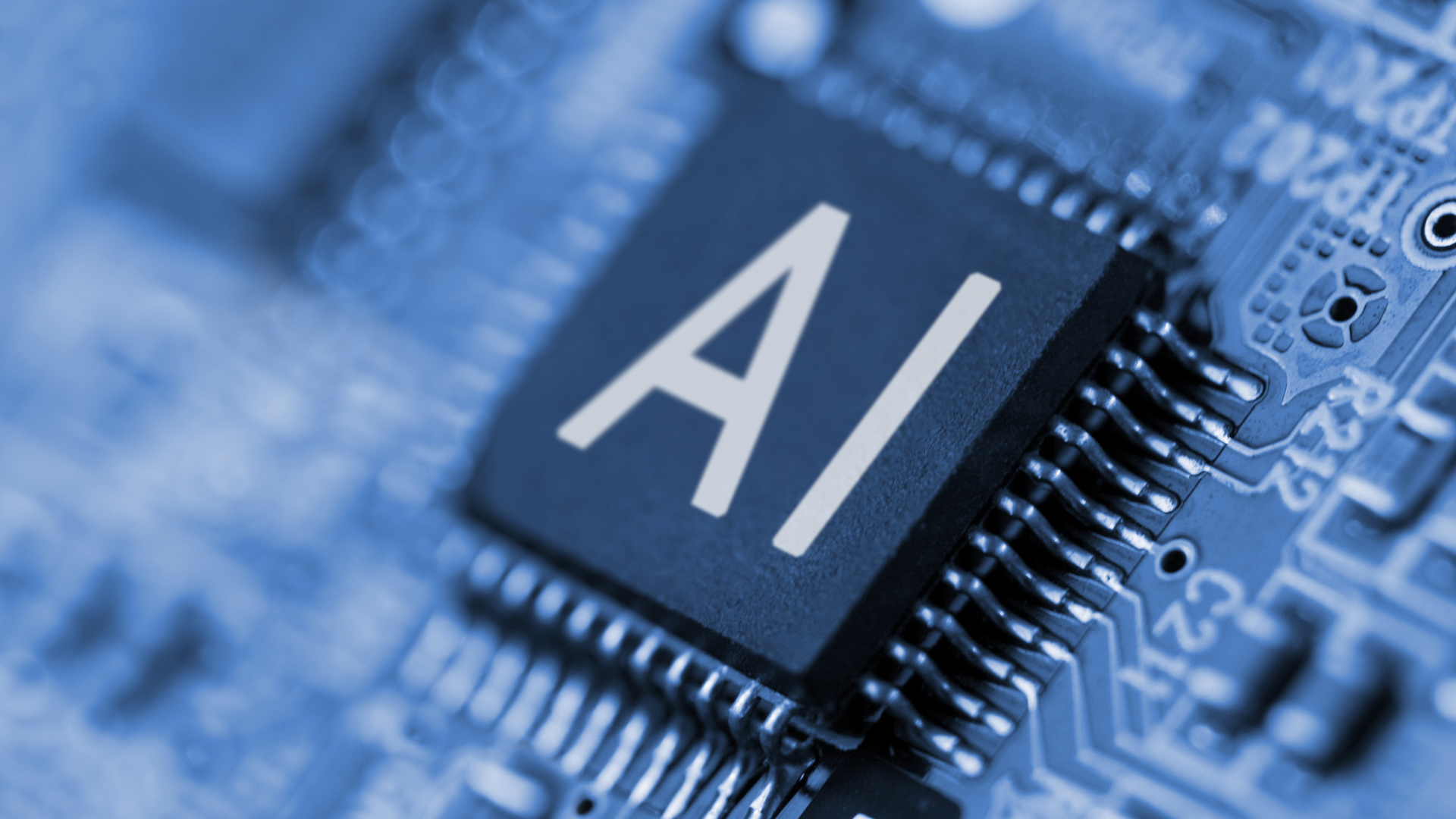Sich die Inspiration direkt vom Konsumenten geben zu lassen, empfand die Teilnehmerin als Mogelei und warf die Frage auf, ob nicht eigene Geschichten zu schaffen, Teil des kreativen Prozesses einer Autorin sei. Die Berufsbezeichnung müsse eine Art Qualitätssiegel erhalten, durch eine nachweisbare Ausbildung, Berufserfahrung und Arbeitsweise.
Dieser Ausgangspunkt warf die Frage auf, inwiefern kreative Arbeit mithilfe von KI wirklich noch kreativ ist: Müsste kreative Arbeit neu definiert werden, wenn generative Tools handwerkliche Fähigkeiten scheinbar überflüssig machen?
Hier gilt es eine klare Unterscheidung zu machen:
Zwischen der inhaltlichen Debatte darüber, was wir persönlich als kreativ empfinden,
den politischen Definitionen, die eine Behörde wie die KSK braucht,
und den individuellen Perspektiven von Gestalter:innen, die ihre eigene Arbeit schützen wollen.
Die KSK, so wurde mehrfach betont, ist keine Kulturinstanz. Sie entscheidet nicht, was Kunst ist, sondern nur, ob eine Tätigkeit im Sinne des KSVG als künstlerisch gilt. Und genau hier entsteht die Reibung: Wenn generative Tools es ermöglichen, mit wenigen Eingaben scheinbar fertige Ergebnisse zu produzieren, stellt sich die Frage, ob damit nicht auch der Begriff von künstlerischer Arbeit selbst unter Druck gerät.
Werkzeug oder Werk? Wo beginnt die künstlerische Tätigkeit?
Ein zentrales Motiv der Diskussion war die Frage nach den Fertigkeiten: Wenn man keine zeichnerische, malerische oder handwerkliche Fähigkeit mehr braucht, weil die KI sie simuliert, ist man dann noch Gestalter:in? Oder anders gefragt: Reicht es, ein Ziel zu formulieren und das Tool auszuführen, oder liegt die kreative Leistung woanders?
Viele Wortmeldungen waren sich darin einig: Kreativität beginnt nicht beim Befehl „Mach mal schön“. Sie beginnt dort, wo jemand entscheidet, was schön sein soll, warum und für wen. In dieser Lesart bleibt KI ein Werkzeug, wenn auch ein extrem mächtiges. Die eigentliche Leistung liegt weiterhin in der Konzeption, der Auswahl, der Bewertung, der Weiterentwicklung.
Gleichzeitig wurde aber auch eingeräumt: Diese Unterscheidung ist praktisch kaum überprüfbar. Niemand kann am fertigen Werk sehen, wie viel Denken, wie viel Entscheiden, wie viel Reflexion darin steckt. Doch eben diese Frage stellt die KSK nicht. Sie sieht nur das Ergebnis, nicht den Prozess.
Qualitätsneutralität, Ungerechtigkeit und die Angst vor Ausnutzung
Ein besonders intensiver Teil der Diskussion drehte sich um dieses scheinbar paradoxe Problem: Das KSVG unterscheidet bewusst nicht zwischen guter und schlechter Kunst. Und das ist eigentlich eine Stärke. Denn wer sollte sonst entscheiden, was „gut genug“ ist? Eine Behörde? Ein Gremium? Ein Algorithmus?
Genau diese Qualitätsneutralität schützt auch heute schon Menschen, deren Arbeit viele vielleicht nicht mögen oder schätzen würden, die aber trotzdem künstlerisch ist. Mehrere Stimmen betonten: Es gibt schon immer schlechte Gestaltung, schlechte Bücher, schlechte Plakate. Trotzdem sind das kreative Leistungen. Niemand würde auf die Idee kommen, sie aus der KSK auszuschließen.
Doch mit KI verschärft sich dieses Gefühl von Ungerechtigkeit. Es wurde offen ausgesprochen: Es fühlt sich unfair an, wenn jemand mit wenigen Prompts Ergebnisse produziert und damit möglicherweise denselben Status bekommt wie jemand, der seit Jahrzehnten gestalterisch arbeitet. Einige äußerten die Sorge, dass die KSK dadurch „ausgenutzt“ werden könnte, wenn eine gute Einarbeitung in generative KI genügt, um in die Künstlersozialversicherung aufgenommen zu werden.
Doch die KSK war nie ein Qualitätssiegel. Sie war nie dafür da, Exzellenz zu bewerten. Sie schützt Tätigkeiten, nicht Talente. Und sie schützt auch Menschen, deren Arbeit viele für banal oder belanglos halten würden. Genau das macht sie als Institution stark und politisch stabil.
Mehrfach wurde betont: Wenn man anfängt, kreative Arbeit nach „Echtheit“, „Tiefe“ oder „handwerklicher Schwierigkeit“ zu bewerten, öffnet man eine Tür, die man nicht mehr schließen kann. Dann müsste man auch all jene ausschließen, die heute schon mit Templates arbeiten, mit Stockmaterial, mit automatisierten Tools.
Oder wie es sinngemäß hieß: Wenn schlechte Kunst kein Ausschlusskriterium ist, kann KI-Nutzung auch keins sein.
Kein Abschluss, sondern eine Verschiebung
Am Ende dieses Treffens war klar: Die ursprüngliche Frage der KSK nach neuen Tätigkeitsfeldern durch KI ist inzwischen weniger brisant als die Frage, wie kreativ definierte Arbeit überhaupt noch beschrieben werden kann, wenn Werkzeuge immer mächtiger werden.
Man gelangte zu der Einsicht, dass die KSK nicht zum Kulturgericht werden darf, auch wenn neue Technologien diese Rolle scheinbar herausfordern.